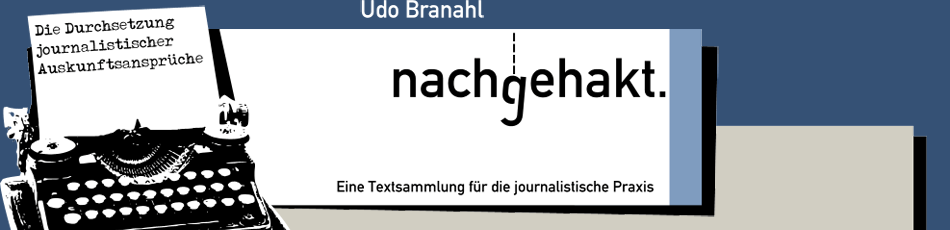


Teil A:
Informationsansprüche und ihre Durchsetzung im Überblick
Welche Informationsansprüche gibt es?
Ein Überblick
Journalisten haben ein Auskunftsrecht gegenüber Behörden, das ihnen in den Landespressegesetzen garantiert wird. Sie können sich aber auch – wie jeder andere Bürger – auf die Informationsfreiheitsgesetze (IFG), die Umweltinformationsgesetze (UIG) und das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) berufen.
Welche Vor- und Nachteile bieten diese Anspruchsgrundlagen?
Informationen über Unternehmen, Vereine und Grundeigentümer lassen sich durch einen Blick ins Handelsregister, ins Vereinsregister und ins Grundbuch gewinnen.
Wann darf ein Journalist in die genannten Register schauen?
Journalistischer Auskunftsanspruch
nach den Landespressegesetzen
Wer?
Auf den journalistischen Auskunftsanspruch können sich Vertreter des Rundfunks und der Presse (dazu gehören auch Buchverlage und Agenturen) berufen. Er gilt auch für Mitarbeiter anderer Mediendienste, die journalistisch-redaktionell arbeiten und periodisch erscheinen, zum Beispiel im Internet. Die Qualität der Publikation ist dabei nicht von Belang, weil der Staat eine Neutralitätspflicht gegenüber der Presse hat.
Freie Mitarbeiter sind genauso auskunftsberechtigt wie Redakteure, allerdings brauchen sie entweder einen Presseausweis oder ein Legitimationsschreiben ihrer Redaktion.
Mitarbeiter anderer Organisationen können Auskunftsansprüche nach den Landespressegesetzen nur dann geltend machen, wenn die Organisation entsprechende periodische Druckwerke oder Mediendienste betreibt und sie sich als Mitarbeiter dieses Druckwerks oder Mediendienstes ausweisen können (Legitimationsschreiben genügt.).
Ohne einen entsprechenden Nachweis verweigerte z.B. die Pressesprecherin des Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt Frank Brendel Auskünfte, die dieser im Auftrag der Verbraucherorganisation foodwatch begehrt hatte.
Gegen wen?
Der journalistische Auskunftsanspruch richtet sich nur gegen den Staat, nicht gegen einzelne Bürger, Unternehmen oder Vereine. Den presserechtlichen Auskunftspflichten unterliegen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden. Auskunftspflichtig sind nicht nur (Verwaltungs-)Behörden im engeren Sinn, sondern alle staatlichen Stellen, also auch Parlamente, Gerichte, Eigenbetriebe von Bund, Ländern und Gemeinden (Theater, Schwimmbäder, Krankenhäuser), aber auch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Kirchen müssen nur Auskünfte geben, wenn es um staatliche Angelegenheiten (zum Beispiel Kirchensteuer) geht, aber nicht, wenn geistliche Belange (zum Beispiel die Gestaltung der Gottesdienste) betroffen sind. Auch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind nur dann auskunftspflichtig, wenn sie wie eine Behörde tätig werden, also zum Beispiel beim Gebühreneinzug, nicht aber bei redaktionell-journalistischen Inhalten, bei der Programmgestaltung und der inneren Organisation.
Staatsunternehmen, die in einer privatrechtlichen Organisationsform (Aktiengesellschaft, GmbH o.ä.) betrieben werden, sind auskunftspflichtig, solange der Staat die Mehrheit der Anteile hält (Stadtwerke, Müllabfuhr, Bahn). Unternehmen, die vom Staat mit hoheitlichen Aufgaben (zum Beispiel Vergabe der TÜV-Plaketten) beauftragt sind, müssen nur Auskünfte geben, wenn es konkret um diese vom Staat übertragene Aufgabe geht, nicht zu ihren sonstigen Geschäftstätigkeiten.
► Beispiele für die Auskunftspflicht solcher Unternehmen:
- Renate Daum ./. LfA Förderbank Bayern
(Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Teil D) - Peter Kveton ./. Olympiapark München GmbH
(Urteil des Landgerichts München im Teil D)
Grenzen:
Der Presse können Auskünfte verweigert werden, wenn
- durch ihre Erteilung die sachgemäße Durchführung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte,
- Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen,
- ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde oder
- ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet (fehlt in einigen Landespressegesetzen).
Allerdings muss die Behörde im Einzelfall immer prüfen, ob das Informationsinteresse der Öffentlichkeit höher steht als die oben genannten Gründe.
Vorteile:
Die Behörde muss die Auskunft unverzüglich und kostenlos erteilen. Gebühren können allenfalls für das Anfertigen von Kopien verlangt werden.
Zudem ist es relativ einfach, sich auf den journalistischen Auskunftsanspruch zu berufen; die Mitarbeiter von Behörden wissen in der Regel, dass sie eine Auskunftspflicht gegenüber der Presse haben. Die relativ neuen Informationsgesetze (IFG, UIG, VIG) muss man dagegen oft erst erklären, was zu Verzögerungen führen kann.
Nachteile:
Die Form der Auskunft liegt im Ermessen der Behörde. Sie kann entscheiden, ob sie die Anfrage mündlich oder schriftlich beantwortet, Aktenauszüge herausgibt, eine Presseerklärung verbreitet oder zu einer Pressekonferenz einlädt. Nur in Ausnahmefällenkönnen Journalisten verlangen, die Akten einsehen zu dürfen.
Das Informationsfreiheitsgesetz
Wer?
Auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) kann sich jeder berufen.
Gegen wen?
Generell informationspflichtig sind die Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder, die ein Informationsfreiheitsgesetz haben7. In diesen Ländern haben auch die Kommunalbehörden Zugang zu den bei ihnen vorhandenen Informationen zu gewähren. Dasselbe gilt für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Bundes oder eines dieser Länder unterstehen, sowie für Personen des Privatrechts, die von diesen mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind.
Parlamente und Gerichte unterliegen den IFG’s nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.
So verpflichten die IFG’s Staatsanwaltschaften und Gerichte z.B., Informationen über Geschäftsanfall, Entwicklung von Stellenplänen und die Dauer der von ihnen betriebenen Verfahren herausgeben, nicht aber Auskünfte zum Stand einzelner Verfahren zu erteilen.
Stellen, die nur teilweise öffentlich-rechtlich tätig werden, müssen auch nur insoweit Informationszugang gewähren.
Das gilt insbesondere für die Kreditinstitute des Bundes, der Länder und der Gemeinden.
Inhalt:
Zugang kann generell zu allen amtlichen Aufzeichnungen verlangt werden, die sich im Besitz der Behörde befinden. Eine thematische Beschränkung sehen die Informationsfreiheitsgesetze nicht vor.
Grenzen:
Die Grenzen der Zugangsfreiheit sind denen des journalistischen Auskunftsanspruchs sehr ähnlich. Die Ausnahmevorschriften sind aber genauer gefasst. Sie sollen einerseits verhindern, dass die Funktionsfähigkeit der Verwaltung gestört wird, und andererseits dem Schutz persönlicher Daten, geistigen Eigentums und von Betriebs- sowie Geschäftsgeheimnissen dienen.8
Vorteile:
Der Antragsteller kann die Form, in der er die Information erhalten will, selbst festlegen (mündliche Auskunft, Kopien von Schriftstücken). Insbesondere kann er auch Akteneinsicht verlangen.9 Die Behörden des Bundes und einiger Bundesländer10 dürfen die Informationen anstelle der beantragten Akteneinsicht jedoch in einer anderen Form zugänglich machen, wenn dies einen (deutlich) geringeren Verwaltungsaufwand erfordert.
Der Informationswunsch muss nicht begründet werden. Verdeckt recherchierende Journalisten müssen sich – anders als beim journalistischen Auskunftsanspruch – nicht zu erkennen geben, weil sie auch als Privatpersonen Anträge stellen können. Allerdings müssen sie damit rechnen, dass der Betroffene von ihrer Anfrage erfährt. Denn die Behörde hat Dritten, deren Belange durch den Informationszugang berührt sein können, vorab Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Nachteile:
Informationsfreiheitsgesetze gibt es nicht in allen Ländern. Die Behörde hat mindestens einen Monat Zeit, über den Antrag zu entscheiden.
Außerdem sind nur mündliche Auskünfte und die Ablehnung des Antrages kostenlos.
| ► | Über die möglichen Kosten einer Auskunft nach dem IFG informiert der Beitrag von Katja Reich. |
Tipp: Es kann sinnvoll sein, als Journalist zunächst eine kostenlose journalistische Auskunft zu verlangen. Wenn man Zweifel an dieser hat, kann man danach eine Akteneinsicht nach IFG verlangen. So spart man nicht nur Kosten, sondern kann eventuell auch präziser nachfragen, da man eine erste behördliche Auskunft schon vorliegen hat.
Das Umweltinformationsgesetz
Wer?
Wie beim IFG kann sich auch jeder auf das Umweltinformationsgesetz (UIG) berufen.
Gegen wen?
Umweltinformationsgesetze gelten sowohl im Bund wie auch in allen Bundesländern. Auskunftspflichtig sind Verwaltungsbehörden und Unternehmen, die im Umweltschutz tätig sind, z.B. Abfallentsorgungsunternehmen.11
Inhalt:
Die UIG’s eröffnen den Zugang nur zu Umweltinformationen. Dazu gehören Daten über
- den Zustand der Umwelt,
- Faktoren, die sich auf den Zustand der Umwelt auswirken ( wie z.B. Emissionen, Abfall- und Abwasserentsorgung),
- Maßnahmen und Tätigkeiten, die sich auf die Umwelt auswirken oder ihren Schutz bezwecken, und
- Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die menschliche Gesundheit und den Zustand von Kulturstätten und Bauwerken.
Grenzen:
Die Ausnahmeregelungen der UIG’s ähneln denen der IFG’S.12
Vorteile:
Der Wunsch nach einer Auskunft muss wie beim IFG nicht begründet werden.
Generell kann der Journalist die Form, in der er die Information erhalten will, auch hier selbst festlegen (mündliche Auskunft, Kopien von Schriftstücken,…). Insbesondere kann er auch Akteneinsicht verlangen. Die Behörden des Bundes und der meisten Bundesländer dürfen die Informationen anstelle der beantragten Akteneinsicht jedoch in einer anderen Form zugänglich machen, wenn dies einen (deutlich) geringeren Verwaltungsaufwand erfordert.13
Um Informationen nach dem UIG zu erhalten, müssen sich verdeckt recherchierende Journalisten nicht zu erkennen geben, weil sie auch als Privatpersonen Anträge stellen können. Allerdings müssen sie damit rechnen, dass der Betroffene von ihrer Anfrage erfährt, wenn sie die Preisgabe von personenbezogenen Daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen verlangen. In diesem Fall muss die Behörde die Betroffenen vor ihrer Entscheidung nämlich anhören.
Nachteile:
Der Informationszugang kann erhebliche Kosten verursachen. Kostenlos sind nur einfache mündliche oder schriftliche Auskünfte. Auch für die Ablehnung eines Antrages werden keine Kosten erhoben. Muss die Behörde aber erheblichen Aufwand betreiben, um den gewünschten Zugang zu der Information zu ermöglich, kann die Sache teuer werden.
| ► | Über die möglichen Kosten einer Auskunft nach dem UIG informiert der Beitrag von Katja Reich. |
Das Verbraucherinformationsgesetz
Wer?
Informationsansprüche nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) des Bundes kann jeder geltend machen.
Gegen wen?
Informationspflichtig sind Verwaltungsbehörden des Bundes und der Länder, zu deren Aufgaben die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln gehört, sowie Privatpersonen und Unternehmen, die öffentliche Aufgaben oder Tätigkeiten in diesem Bereich wahrnehmen und dabei der Kontrolle einer Behörde unterliegen.
Kommunalbehörden unterliegen der Informationspflicht nur in den Ländern, in denen dies durch Landesgesetz ausdrücklich bestimmt ist.
Inhalt:
Das VIG gewährt Zugang zu Daten über
- Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelrecht,
- Gefahren und Risiken für die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern, die von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen oder Futtermitteln ausgehen,
- Herkunft, Herstellung, Beschaffenheit und Kennzeichnung solcher Erzeugnisse,
- ihrer Ausgangsstoffe und die bei der Gewinnung der Ausgangsstoffe angewendeten Verfahren sowie
- behördliche Tätigkeiten und Maßnahmen in diesem Bereich.
Grenzen:
Zweifel an der Wirksamkeit des VIG ergeben sich vor allem daraus, dass es weitreichende Beschränkungen zum Schutz der Vertraulichkeit von Behördenberatungen enthält.
Zwar darf die Behörde Informationen über Rechtsverstöße nicht unter Berufung auf den Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse verweigern. Doch selbst bei Rechtsverstößen gewährt das VIG keinen Zugang zu den Informationen, die die Behörde von dem betreffenden Unternehmen auf Grund einer Meldepflicht erhalten hat.
Nach Ablauf von fünf Jahren sind Informationen über Rechtsverletzungen nicht mehr zugänglich.
Vorteile:
Der Wunsch nach einer Auskunft muss wie beim IFG und beim UIG nicht begründet werden.
Auch die Berufung auf das VIG hat den Vorteil, dass sich verdeckt recherchierende Journalisten nicht zu erkennen geben müssen, weil sie auch als Privatpersonen Anträge stellen können. Allerdings können sie nicht verhindern, dass der Betroffene von ihrer Anfrage erfährt. Denn die Behörde hat „Dritten, deren Belange durch den Antrag auf Informationszugang betroffen sind“, vor ihrer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Nachteile:
Das VIG gewährt keinen Anspruch auf Akteneinsicht. Vielmehr kann die informationspflichtige Stelle nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie eine Auskunft erteilt, Akteneinsicht gewährt oder den Informationszugang in anderer Weise ermöglicht.
Die Bearbeitungsfrist beträgt einen Monat, bei vorheriger Anhörung des Betroffenen zwei Monate.
Nur der Zugang zu Informationen über Rechtsverstöße ist kostenfrei. Im Übrigen werden kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. Soweit es nicht um Informationen über Rechtsverstöße geht, werden Journalisten deshalb im Zweifel besser eine kostenlose Auskunft nach dem Landespressegesetz verlangen.
6 In einer durch Udo Branahl überarbeiteten und erweiterten Fassung.
7 Das ist in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, im Saarland und in Thüringen der Fall. Kein IFG haben dagegen die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, und Sachsen. In Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt ist eines in Vorbereitung.
8 Zu den Einzelheiten vgl. unten Teil B: Informationsfreiheitsgesetze
9 Das gilt uneingeschränkt allerdings nur in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.
10 Eine entsprechende Regelung enthalten die IFG’s von Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.
11 Zu den Einzelheiten vgl. unten Teil B Umweltinformationsgesetze.
12 Zu den ‚Einzelheiten vgl. unten Teil B Umweltinformationsgesetze.
13 Ohne Einschränkung gilt der Anspruch auf Akteneinsicht nur in Berlin. In Bayern und Rheinland-Pfalz genügt es dass es für die informationspflichtige Stelle „angemessen“ ist, die Informationen auf andere Art zugänglich zu machen.
